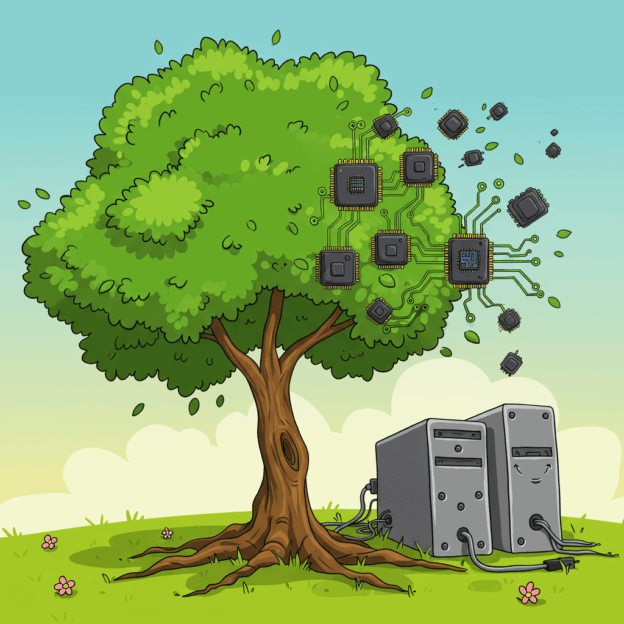Die Digitalisierung wird oft als Schlüssel zur Nachhaltigkeit gesehen, doch diese Sichtweise greift zu kurz. Während die Digitalisierung in bestimmten Bereichen tatsächlich positive Auswirkungen haben kann, birgt sie auch Herausforderungen und unerwünschte Nebeneffekte.
Das Jevons Paradoxon passt da ganz gut. Jevons was? Auch Rebound-Effekt genannt, beschreibt er grob gesagt, dass Effizienzsteigerungen oft zu einer Mehrnutzung führen.
In seinem 1865 erschienenen Buch „The Coal Question“ stellte der englische Ökonom William Stanley Jevons fest, dass Englands Kohleverbrauch sich trotz effizienterer Dampfmaschine von James Watt vervielfachte, da sie jetzt in vielen neuen Bereichen eingesetzt wurde.
Heutige Beispiele sind effizientere Speichertechnologien, die zwar die Kosten pro Gigabyte senken, aber gleichzeitig zu exponentiell wachsenden Datenmengen führen. 2010 gab es 2 Zettabyte globale Daten, die Prognose für 2025 lautet 181 Zettabyte.
Oder KI, trotz energieeffizienterer Prozessoren steigt der Stromverbrauch von KI-Systemen massiv an. Effizienzgewinne ermöglichen komplexere Modelle und breitere Anwendungen – etwa in automatisierten Dokumentationssystemen oder Datenanalysen, was den Gesamtenergiebedarf erhöht.
Die Verdopplung der Transistordichte alle zwei Jahre führte statt zu sparsameren Geräten, zu leistungsfähigeren Computern mit höherem Strombedarf. Moderne Software nutzt die gesteigerte Rechenleistung voll aus, etwa durch aufwendigere Grafiken oder KI-Funktionen.
Ein besonders kritischer Punkt ist die riesige Menge an Datenmüll, die im Internet schlummert. Studien zufolge sind 85 Prozent der gespeicherten Daten unnötig.
Stellen wir uns vor: doppelte Fotos, alte E-Mail-Anhänge, ungenutzte Cloud-Backups – ein gigantischer, unnötiger Datenberg. Diese Daten verbrauchen nicht nur Speicherplatz, sondern auch Energie für die Kühlung der Server und die Datenübertragung. Wir leben im Zeitalter des Zettabytes, einer unvorstellbaren Datenmenge, die ständig wächst. Die Aufräumarbeiten sind schwierig, da viele Nutzer ihre Daten in Clouds speichern und den Überblick verlieren. Das Problem ist, dass diese Daten, selbst wenn sie selten genutzt werden, ständig Strom verbrauchen.
Die geplante Obsoleszenz, also die absichtliche Verkürzung der Lebensdauer von Produkten, ist ein weiteres Problem. Häufig werden Geräte ausgetauscht, obwohl sie noch funktionieren. Besonders problematisch ist dies bei Smartphones, deren Software-Updates oft nach wenigen Jahren eingestellt werden. Die EU hat zwar Regulierungen erlassen, um die Lebensdauer von Geräten zu verlängern, doch die Hersteller finden oft Wege, diese zu umgehen. Zudem wird bei der Betrachtung des ökologischen Fußabdrucks oft die energieintensive Produktion von Hardware vernachlässigt.
Den tatsächlichen Ressourcenverbrauch eines Produkts ehrlich zu ermitteln ist quasi unmöglich, da dazu alle Prozesse angefangen bei der Gewinnung der Rohstoffe über die Herstellung der Hardware bis zur Lieferung gehören.
Die Frage ist, wie können wir als Einzelkonsumenten den Überblick behalten und nachhaltige Entscheidungen treffen?
Allgemeine Möglichkeiten wären, auf Energieeffizienzklassen zu achten, die die EU nun auch für Smartphones und Tablets plant. Wenn möglich, sollten wir Geräte reparieren lassen, anstatt sie zu ersetzen. Wir sollten den Ausbau erneuerbarer Energien unterstützen und selbst auf Ökostrom umsteigen.
Es ist wichtig, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Digitalisierung nicht automatisch nachhaltig ist und unseren Konsum kritisch zu hinterfragen. Die Illusion, dass Digitalisierung per se nachhaltig ist, muss durchbrochen werden. Die Realität ist, dass die Digitalisierung, wie wir sie derzeit erleben, oft zu einem erhöhten Ressourcenverbrauch führt. Dies zeigt sich nicht nur in unseren Clouds und Smartphones, sondern auch in anderen Bereichen unseres digitalen Lebens.
Ein Beispiel für die Ambivalenz der Digitalisierung sind Videokonferenzen. Sie ermöglichen es, Fahrten und Flüge zu reduzieren und somit Emissionen einzusparen. Doch gleichzeitig hat die Verfügbarkeit von Videokonferenzen zu einer Zunahme der virtuellen Meetings geführt. Oft werden diese Meetings ohne klare Agenda und mit einer großen Anzahl von Teilnehmern abgehalten, was zu Ineffizienz und unnötigem Energieverbrauch führt. Studien zeigen, dass ein bewussterer Umgang mit Videokonferenzen, beispielsweise durch das Abschalten der Kameras bei nicht-sprechenden Teilnehmern, den Energieverbrauch deutlich reduzieren kann.
Ein weiteres Beispiel ist der Cloud-Speicher. Er bietet uns die Möglichkeit, unsere Daten von überall aus abzurufen und zu teilen. Doch die Speicherung großer Datenmengen in Rechenzentren ist mit einem hohen Energieverbrauch verbunden. Wir sollten uns daher fragen, ob wir wirklich alle unsere Daten in der Cloud speichern müssen oder ob eine lokale Speicherung nicht oft die nachhaltigere Alternative ist.
Auch der E-Commerce wirft Fragen auf. Er ermöglicht uns ein bequemes Einkaufen von zu Hause aus, doch der Versand der Waren verursacht zusätzliche Emissionen durch Transport und Verpackung. Zudem verleitet das große Angebot und die ständige Verfügbarkeit im Netz zu Impulskäufen und einem höheren Konsum. Hier gilt es, bewusster einzukaufen und lokale Geschäfte zu unterstützen, um Transportwege zu verkürzen und Verpackungsmüll zu reduzieren.
Streaming-Dienste wie Netflix und Spotify sind sehr beliebt. Anstatt DVDs oder CDs zu kaufen, können wir Filme und Musik einfach online streamen. Dies scheint zunächst umweltfreundlicher zu sein, da keine physischen Produkte hergestellt und transportiert werden müssen. Allerdings verbrauchen Streaming-Dienste riesige Mengen an Daten, was wiederum zu einem hohen Energieverbrauch in Rechenzentren führt. Zudem verleitet das unbegrenzte Angebot oft dazu, mehr zu konsumieren, als wir es früher getan hätten.
Kryptowährungen wie Bitcoin werden oft als dezentrale und umweltfreundliche Alternative zum traditionellen Finanzsystem angepriesen. Allerdings verbraucht das „Mining“ enorme Mengen an Energie. Hier sind energieeffizientere Kryptowährungen oder vielleicht gar keine gefragt..-)
Der Umstieg von Windows 10 auf 11 ist ein Paradebeispiel für geplante Obsoleszenz. Millionen PCs werden einfach ausgemustert, weil sie „offiziell“ nicht mehr unterstützt werden. Und was passiert mit den alten Geräten? Sie landen auf dem Elektroschrott, wo sie wertvolle Ressourcen verschwenden und die Umwelt belasten.
Das Internet der Dinge führt zu einer explosionsartigen Zunahme vernetzter Geräte, deren Produktion und Entsorgung Ressourcen verbraucht und Elektroschrott erzeugt.
Diese Probleme sind nicht nur auf individuelles Verhalten zurückzuführen, sondern haben auch systemische Ursachen. Geschäftsmodelle, die auf Wachstum und Konsum ausgerichtet sind, tragen dazu bei. Hier sind Unternehmen und Politik gefragt, um nachhaltige Digitalisierung zu fördern. Die Kreislaufwirtschaft, die auf Langlebigkeit, Reparaturfreundlichkeit und Recycling setzt, kann ein Lösungsansatz sein. Hier ist auch die Verfügbarkeit von Ersatzteilen ein wichtiger Faktor. Digitale Suffizienz, also der bewusste Verzicht auf unnötige digitale Technologien, kann ebenfalls einen Beitrag leisten. Beispiele dafür sind weniger Streaming und ein bewusster Umgang mit sozialen Medien.
Doch Vorsicht vor Greenwashing: Viele Unternehmen werben mit „grünem Strom“, kaufen aber lediglich Zertifikate, anstatt selbst in erneuerbare Energien zu investieren.
Was können wir konkret tun?
Wir können uns über Initiativen und Organisationen informieren, die sich für nachhaltige Digitalisierung einsetzen. Wir müssen uns bewusst machen, dass jeder Einzelne einen Beitrag leisten kann.
Letztendlich geht es darum, ein Umdenken in der Gesellschaft zu bewirken. Wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass Digitalisierung per se gut für die Umwelt ist und dass technologische Fortschritte automatisch zu mehr Nachhaltigkeit führen. Nur wenn wir unser Konsumverhalten kritisch hinterfragen und nachhaltige Alternativen wählen, können wir die Vorteile der Digitalisierung nutzen, ohne die Umwelt zu belasten. Es liegt an uns allen, einen Beitrag zu einer nachhaltigeren digitalen Zukunft zu leisten.